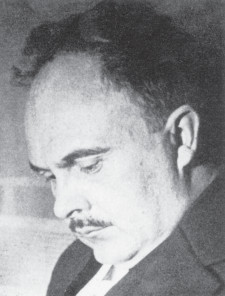
Schardt, Alois J.
| geboren: | 28.12.1889 Frickhofen |
| gestorben: | 24.12.1955 Los Alamos (New Mexico) |
| Konfession: | katholisch |
| Vater: | Landwirt |
Schardt, Alois J.
Kunsthistoriker, Museumsdirektor
Heute weitgehend vergessen gehörte Alois Jakob Schardt zu den prägenden Museumsdirektoren der Weimarer Republik. Er wurde in Frickhofen (Hessen-Nassau) als Sohn eines Landwirts geboren und studierte zwischen 1911 und 1917 mit einer durch den Ersten Weltkrieg verursachten Unterbrechung in Marburg, München und Würzburg Philosophie, Germanistik, Kunstgeschichte und Archäologie. 1917 wurde Schardt mit einer Dissertation zum Thema „Der menschliche Ponderationstypus. Seine Bedeutung für die Kunst, insbesondere für die ägyptische und griechische Plastik“ in Würzburg promoviert. Nach dem Krieg war Schardt zunächst wissenschaftlicher Hilfsarbeiter an der ägyptischen Abteilung der Staatlichen Museen zu Berlin und wechselte im Frühjahr 1920 kurz an das Kaiser-Friedrich-Museum. Vom Sommer 1920 bis ca. 1924 war er als Mitarbeiter und Assistent Ludwig Justis an der Berliner Nationalgalerie in der Abteilung Gegenwartskunst im Kronprinzenpalais tätig. Seit Ende 1923 oder spätestens 1924 leitete Schardt die Bildungsanstalt Hellerau bei Dresden, wo er mit Leihgaben eine Sammlung moderner Kunst aufbaute, bevor er im Sommer 1926 vom Magistrat der Stadt zum Direktor des Moritzburgmuseums in Halle (Saale) berufen wurde. Als Nachfolger von Max Sauerlandt und Paul Thiersch kann er an deren erfolgreiche Tätigkeit anknüpfen und das Museum in Halle neben den Häusern in Berlin, Essen, Hannover oder Mannheim als eines der wichtigsten modernen Kunstmuseen in der Weimarer Republik etablieren, nicht zuletzt durch die Erwerbung von Hauptwerken wie Oskar Kokoschkas Die Auswanderer (1916/17; heute München) und Franz Marcs Tierschicksale (1913; heute Basel).
Schardt suchte und fand schnell Anschluss an die zeitgenössische Kunstszene. Er stand in persönlicher Verbindung zu zahlreichen bildenden Künstlern, war als Kunstkritiker für die „Deutsche Allgemeine Zeitung“ tätig und veröffentlichte in den 1920er Jahren kontinuierlich zur Kunst des deutschen Expressionismus, wobei er sich vorrangig mit Künstlern wie Lyonel Feininger, Paul Klee und Franz Marc beschäftigte, die er in verantwortlicher Position auch durch Ankäufe oder Aufträge förderte. So erschien 1922 im renommierten „Kunstblatt“ Paul Westheims ein umfangreicher Aufsatz zu Lyonel Feininger unter dem Titel „Natur und Kunst in der neueren Malerei“. 1929 beauftragte Schardt Feininger, den Zyklus der heute berühmten Halle-Bilder zu malen.
1930 wurde Schardt an der Universität Halle Honorarprofessor für Museumskunde und Kunstgeschichte und gehörte zu den wenigen Kunsthistorikern, die sich vor dem Zweiten Weltkrieg im akademischen Feld mit der modernen Kunst auseinandersetzten. Heute wird Schardts Name aber vor allem dann genannt, wenn auf die Möglichkeiten und die Versuche der Weiterführung der künstlerischen Moderne während des „Dritten Reichs“ eingegangen wird. Schardt hätte in diesem Zusammenhang fast eine entscheidende Rolle gespielt, denn im Sommer 1933 wurde er zum kommissarischen Leiter der Berliner Nationalgalerie berufen und versuchte an alter Wirkungsstätte ein überzeugendes Konzept der Integration der modernen Kunst in den Kanon einer mit Blick auf die Gegenwart strittigen deutschen Kunst zu entwickeln. Flankiert wurde dies angesichts der Zeitumstände mit der Bitte um Abstammungsnachweise, um die Schardt moderne Künstler ersuchte, um sie vor zukünftigen Anfeindungen schützen zu können. So schrieb Schardts Mitarbeiter Alfred Hentzen an Paul Klee am 8. Juli 1933:
„Durch die Ernennung von Dr. Schardt zu seinem [Justis] kommissarischem Nachfolger ist die Linie, die Justi in der neuen deutschen Kunst vertreten hat, gesichert. Dadurch aber ist der Kampf noch nicht entschieden, die Reaktion wird sich weiter emsig rühren und um einem heute besonders beliebten Argument zu begegnen, bittet Sie Direktor Schardt [...] kurz die Liste Ihrer Vorfahren, möglichst bis zu den Großeltern oder gar noch weiter, aufzuschreiben.“
Mit den erst kürzlich veröffentlichten „Wesensmerkmalen zur deutschen bildenden Kunst“ vom Juni 1933 legte Schardt ein Schlüsseldokument zur frühen nationalsozialistischen Kunstpolitik vor, aufgrund dessen der mit Blick auf die moderne Kunst wichtigste Museumsposten in Deutschland vergeben wurde. Die Denkschrift und Schardts Agieren in Berlin zeigen, in welchem Maße er sich mit den Machthabern – für deren Ideologie er durchaus Sympathien hegte – gemein zu machen versuchte, um seine spezifischen Vorstellungen zu realisieren. Mit seinem durchdachten und langfristig entwickelten, wenn auch höchst fragwürdigen kunsthistorischen Rahmenkonzept musste Schardt innerhalb eines überwiegend die künstlerische Mediokrität züchtenden neuen Staates aber wohl zwangsläufig scheitern. Deutlich wurde das nicht nur angesichts der untersagten Wiedereröffnung des Kronprinzenpalais sondern auch angesichts der Probleme mit der Publikation seines Franz-Marc-Buches von 1936, dessen Weiterverbreitung untersagt wurde.
Doch Schardt war nicht allein ein Kunsthistoriker der Moderne – vor allem des deutschen Expressionismus. 1938 legte er ein Buch zur Initiale und 1941 ein Mittelalter-Buch vor, das Kon- und Divergenzen zu den „Wesensmerkmalen“ aufweist. Zu diesem Zeitpunkt war Schardt jedoch bereits mit seiner Familie in die USA ausgereist. Nach dem Scheitern in Berlin hatte Schardt seine Dienstgeschäfte in Halle, in das er 1934 zurückgekehrt war, nicht wieder aufgenommen. Stattdessen hielt er noch einige Vorträge und ließ sich auf eigenen Wunsch zum 1. November 1936 pensionieren, nachdem er wegen einer Rede zur Eröffnung einer Franz-Marc-Ausstellung in Berlin verhaftet worden war. 1937 wurde ihm sein Lehrauftrag an der Universität Halle entzogen. Bis 1939 hält er sich in Berlin auf und vertieft sich in seine Mittelalter-Forschungen. Im November 1939 reist er mit seiner Familie nach Los Angeles, wo er im Auftrag des Berliner Rembrandt-Verlages und mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes eine offizielle Ausstellung des „Dritten Reichs“ zum Thema „Das schöne deutsche Kunstbuch“ lancieren soll. Angesichts der politischen Entwicklung in Europa sowie der Tatsache, dass Schardts Tochter Anna Margaretha gehandikapt ist, entschließt sich die Familie zum Exil in Kalifornien. Nach schwierigen Anfängen kann Schardt wieder unterrichten, unter anderem an der University of Southern California, und wird 1946 Direktor des Art Departments der Olive Hill Foundation.
Auch mit Blick auf die Freundschaft zu Lyonel Feininger sind gewisse Kontinuitäten über alle persönlichen und zeithistorisch bedingten Brüche hinweg zu beobachten. Schardt steuerte 1944 einen kurzen Katalogtext anlässlich der New Yorker MoMAAusstellung Feiningers bei. Zu dieser Zeit konzipierte Schardt im Exil einen Rückblick auf die Entwicklung der deutschen Kunst seit 1900 und kam darin neben sehr persönlichen und mitunter zweifelhaften Einschätzungen auch zu einer zeitnahen Bewertung der nationalsozialistischen Kunst wie Kunstpolitik. Schardt war ein ambitionierter Kunsthistoriker, der innerhalb des „Dritten Reichs“ zu reüssieren suchte, der scheiterte und den Weg ins Exil ging, dessen Grundpositionen aber schon in der frühen Weimarer Republik formuliert worden waren. Gerade diese Kontinuität macht das Beispiel Alois J. Schardts, der am 24. Dezember 1955 in Los Alamos (New Mexico) starb, faszinierend
und problematisch zugleich.
Ausgewählte Publikationen von Alois Schardt
- Natur und Kunst in der neueren Malerei. In: Das Kunstblatt 6 (1922), 96–118.
- Beitrag zur Frage der Museumsgestaltung. In: Kreis von Halle 1 (1930/31), Heft 4, 122–129.
- Franz Marc. Berlin 1936.
- Die Initiale. Phantasie und Buchstabenmalerei des frühen Mittelalters. Berlin 1938.
- Die Kunst des Mittelalters in Deutschland, Berlin 1941.
Quellen und Literatur
- Eberle 387.
- Andreas Hüneke: Im Takt bleiben oder taktieren? – Alois J. Schardt. In: Avantgarde und Publikum. Zur Rezeption avantgardistischer Kunst in Deutschland 1905–1933, hg. von Henrike Junge. Köln, Weimar, Wien 1992, 283–290.
- Andreas Hüneke: Alois Schardt und die Neuordnung der Nationalgalerie nach völkischen Gesichtspunkten. In: „der deutschen Kunst ...“, hg. von Claudia Rückert und Sven Kuhrau. Amsterdam 1998, 82–96.
- Katja Schneider: „Jede Museumsgestaltung hat vom Kunstwerk auszugehen“. Alois Schardt und die Museumskunde in Halle. In: 100 Jahre Kunstgeschichte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, hg. von Wolfgang Schenkluhn. Halle 2004, 151–162.
- Andreas Hüneke: Das schöpferische Museum. Eine Dokumentation zur Geschichte der Sammlung moderner Kunst 1908–1949, hg. von Katja Schneider. Stiftung Moritzburg Halle 2005, 122–204.
- Alois J. Schardt – Ein Kunsthistoriker zwischen Weimarer Republik, „Drittem Reich“ und Exil, hg. von Ruth Heftrig, Olaf Peters und Ulrich Rehm. Berlin 2013.
Bild: Alois Schardt um 1932, aus: Hüneke 2005, 20 (Archiv Hüneke).
Dokument
Wir können die Werke derjenigen Künstler am vollkommensten, am eindeutigsten in uns neu erleben, deren Gefühlsveranlagung, Richtung, Einstellung wir am nächsten stehen, mit denen wir gewissermaßen eine gemeinsame Erlebnisbasis haben. Daß die meisten Menschen nun aber gerade die Künstler unserer Zeit nicht verstehen, liegt daran, daß sie sich noch garnicht klar geworden sind über die Gefühlseinstellung unserer Zeit, daß eine gemeinsame Erlebnisbasis eben nicht vorhanden ist. Sie wenden sich lieber anderen Zeiten und Völkern zu, wobei ihr Verhältnis zu den Kunstwerken aber auch ein ästhetisch-platonisches bleibt. – Diejenigen aber, die unsere Zeit erleben, erfassen auch in der Kunst anderer und früherer Völker den menschlichen Kern, der alle Kunst miteinander verbindet, erfassen ahnend jene große Einheit, aus der sie erwachsen ist. Und gerade das erfüllt uns mit einem andächtigen Staunen angesichts ägyptischer, romanischer oder gotischer Kunstwerke. Wie die Pyramide des Chefren in Jahrzehntelanger Arbeit von Tausenden von Menschen erbaut, sich in dem einen Werk, diese Tausende von Menschen, von denen doch jeder sein eigenes Leben hatte, so ganz einheitlich zusammengeschlossen, daß nirgends auch nur die geringste Schwankung zu verspüren ist bei einer Spannung von Energie, wie sie unsere ganze Elektrizität zusammen nicht hervorbringen kann. Das staunen wir wie ein Wunder an. Ebenso bei einem gotischen Dome. Alle diese unzähligen Spitzen, Ecken und Türmchen von tausenden einzelnen in lebendiger Arbeit geschaffen. Aber all diese einzelnen, nicht nur von Jahrzehnten, sondern oft von mehr als einem Jahrhundert bilden eine große Einheit, keine Dissonanz, keine Spur von Disharmonie. Die einen konnten das Werk der andern fortsetzen. Der Dom steht so vollkommen als etwas Ganzes da, als ob er an einem Tag entstanden sei, von einem Meister, als ob er mit dem einen Machtwort: „es werde“ geschaffen worden sei. Ebenso zeigen Kunstwerke der indischen, der ostasiatischen Kunst nur in verschiedenen Variationen dieselbe grandiose Einheit. Es liegt nicht an der Fülle der Bautätigkeit, denn dann müßten die Werke eines Ramsis II. die der früheren Zeiten weitaus überragen. – An Anzahl ja. Aber eine Chefren-Statue wiegt alle diese vielen Werke der späteren Zeit auf. An Bautätigkeit hat es wirklich auch unserer eigenen Zeit nicht gemangelt. Riesenstädte sind errichtet und große Dome gebaut worden. Sie zeigen nur, daß innere Kraft nichts zu tun hat mit einer äußerlich formalistischen Scheinkraft.Wenn wir das Wort Einheit näher begreifen, uns darüber eine klarere Vorstellung machen wollen, warum eine so geheimnisvolle Kraft dahintersteckt, so müssen wir uns an unsere eigene intellektuelle Einheit erinnern. Wir führen die Kinder schon mit dem 6. Jahre offiziell, inoffiziell schon viel früher in die Gesetze einer geregelten Denktätigkeit ein und wenn das Kind mit zwölf Jahren aus der Schule kommt, ist es so weit, im großen und ganzen seiner Zeit zu folgen, Anteil zu nehmen, ja bewußt oder unbewußt mitzuwirken an unseren Erfindungen und Entdeckungen. Jeder Bauer liest die Zeitung, verfolgt das was vor sich geht, nimmt Stellung dazu und spielt im öffentlichen Leben oft eine nicht unwichtige Rolle. Der einfachste Mann weiß die Ursachen eines Gewitters zu erklären, weiß, daß der Blitz eine elektrische Entladung ist, kennt die Bestandteile einer Dampfmaschine. Das ganze Volk ist wissenschaftlich so eingestellt, daß jährlich viele Tausende Erfindungen als Patent angemeldet werden. Diese Erfindungen stammen aus allen Gesellschaftsschichten. Eine so großartige Disziplinierung hat das Volk in Verstandessachen stark gemacht und zu gewaltigen Leistungen erzogen, die in ihrer Art nicht unähnlich sind einem Dom oder einer Pyramide. Nur die Richtung ist eine verschiedene. Heute haben wir eine Verstandesgemeinschaft, und zwar innerhalb einer materiellen, nicht religiösen, gefühlsarmen Weltauffassung, damals hatte man eine Gefühlsgemeinschaft. In der romanischen Zeit etwa waren die Leute durch ihren starken Gottesglauben verbunden. Da war der Mensch ein Geschöpf Gottes, in dem Donner und Blitz am Himmel erkannte man Gottes Stimme und ein Komet war der besondere Sendbote Gottes. Das erscheint uns heute Aberglaube, weil wir anders gerichtet sind. Wie tief menschlich aber eine solche Weltanschauung verankert war, erkennen wir
an der Kunst als dem sichtbaren Ausdruck jener Epochen. Bei dem ägyptischen oder indischen Volk war die Weltauffassung wieder eine ganz andere. Aber alle diese Bekenntnisse gingen hervor nicht aus dem intellektuellen, sondern aus dem Gefühlsleben und befähigten den einzelnen, wie wir jetzt alle Erscheinungen verstandesmäßig in uns verarbeiten, alle Erlebnisse gefühlsmäßig zu verarbeiten, auf tiefere innere Gesetze zurückzuführen. Und die Formensprache ihrer jeweiligen Kunst war ihnen eine so selbstverständliche wie es uns das Lesen eines Buches ist, mit genau eben derselben Unterscheidung, daß jeder nur so viel von einem Buch versteht, als er selbst dazu veranlagt ist. – So wie wir die Sehkraft des rechten Auges schwächen, wenn wir nur das linke gebrauchen, so wie wir die Kraft des linken Armes vermindern, wenn wir nur den rechten gebrauchen, so ist unser Gefühlsleben verkümmert, weil wir den Intellekt zu einseitig ausbildeten und es wird viel Geduld kosten, das Versäumte einzuholen.
Aber die Sehnsucht ist da nach dem, was der Intellekt glaubt aus der Welt geschafft zu haben, nach Seele und seelischen Werten. Man will nicht mehr alles nur verstandesmäßig erfassen, sondern auch wieder mit dem Gefühl erleben. Noch sind es nicht alle und ein jeder kämpft, vom andern getrennt – subjektiv – mit persönlicher Willkür. Aber daraus kann eine neue innere Bindung entstehen. – Aber wenn wir nun wirklich den Versuch machen, auf unsere Art hinter die äußeren Erscheinungsformen der Umwelt zu sehen, sie zu einem neuen einheitlichen Ganzen zusammenzufügen, so haben wir ja eine neue Weltauffassung, eine neue Religion. Durch unsere Zeit geht die große Sehnsucht nach Menschlichkeit, Menschenverstehen. Und wenn Franz Marc in sich übereinander türmenden Pferdeleibern die eigene Sehnsucht empfindet und Feininger vor der Steilheit eines Hauses taumelt und sie malerisch zu gestalten sucht, so erfassen beide die Erscheinungen der Umwelt aus menschlichen Motiven heraus. Vielleicht sind hier Anzeichen einer neuen Lebensauffassung.
Der Intellekt kann uns keine neue Kraft mehr geben. Er hat mit all seinen Erfindungen unser Seelenleben, unsere Nerven zerrüttet und abgestumpft. Er hat das Volk aufgelöst in ebensoviele Einzelmenschen als es Bewohner hat. Kraft und Zukunft kann uns nur aus einem neu erwachtenGefühlsleben entstehen, aus der Bindung der einzelnen wieder zu einem Ganzen, zu einer völkischen Gefühlsgemeinsamkeit – zu dem Anfang einer neuen Gefühlskultur.
Aus: Verstandeskultur – Kunstbetrachtung – Gefühlskultur; unpublizierter Beitrag für die Zeitschrift Genius (1921), vollständig abgedruckt in: Heftrig/Peters/Rehm 2013, S. 33–44.
Quelle: Friedemann Stengel (Hg.): Ausgeschlossen. Die 1933-1945 entlassenen Hochschullehrer der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Halle 2016, S. 313 - 320
Autor: Olaf Peters



